
POSITIONEN & THEMEN
Ein Theater zur Krise: Herr mit Sonnenbrille am Wiener Schauspielhaus
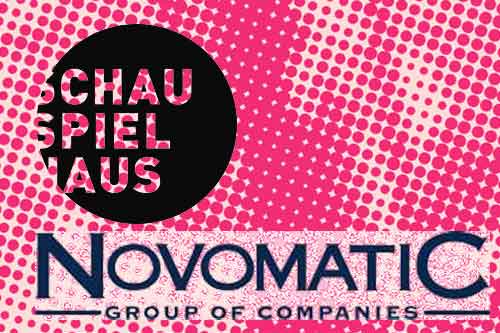 Wer dominiert wohl im ungleichen Spiel zwischen Kunst und Wirtschaft
Wer dominiert wohl im ungleichen Spiel zwischen Kunst und Wirtschaft
Von Christoph Kepplinger (24.2.2010)
Die Wirtschaftskrise macht auch vor dem Theater nicht halt. Zuviel dramatisches Potenzial birgt der ökonomische Niedergang, als dass er nicht hinreichend Stoff für die Bühne böte. Das neueste Stück der jungen Autorin Gerhild Steinbuch, Herr mit Sonnenbrille, das vergangenen Samstag in der Regie von Robert Borgmann im Wiener Schauspielhaus Premiere feierte, ist ein solches Wirtschaftsstück.
Die Szenerie wirkt irgendwie vertraut. Eingebettet in die gut erschlossene Alpenregion, zwischen den großen Brotgebern Fabrik und Tourismusindustrie (gepriesen sei die neue Sechsersesselbahn), ist der Blick auf ein Paar, Mann und Frau, gerichtet, die zwischen zwei Zeitachsen pendeln, dem Vorher und dem Nachher, zwischen glücklich goldener 90er Zeit und dem erschlafften, angegrauten Jetzt, in dem man hier kein Geschäft mehr macht.
Die Ausbeutungsverhältnisse sind klar: dem in die Arbeitslosigkeit ausgemusterten Fabriksarbeiter-Mann verbleiben das ziellose Erklimmen der Berggipfel einerseits und die Gewaltausübung in den eigenen vier Wänden andererseits als Ventil. Keiner Arbeit nachgegangen, das ist jetzt meine Arbeit, lautet sein neues Credo. Der Sprung von der Felswand oder die Axt für den Familienmord lauern als Möglichkeiten immer im Hintergrund.
Sowohl die literarischen als auch die Regie-Anleihen der Inszenierung sind kaum zu übersehen und ergeben einen intertextuellen Fleckerlteppich aus bereits Dagewesenem bei Elfriede Jelinek, Felix Mitterer und Werner Schwab. Während Jelinek aber in ihrem skandalauslösenden Dokumentationsfilm Die Ramsau am Dachstein und in späteren Texten nie vergaß, die Profiteure der schönen Landschaft konkret beim Namen zu nennen, bleibt dies in Herr mit Sonnenbrille völlig ausgeklammert. Dadurch wird freilich gröberer Ärger vermieden. Wachst du auf und denkst, dass das Leben ein falsches Leben ist?, zählt noch zu den rebellischsten Sätzen, der den Figuren auf der Bühne über die Lippen kommt. Rufe wie Mit uns zieht die neue Zeit oder ein kurz angesungenes Arbeiter von Wien verhallen und überdeutlich wird deren Bedeutungslosigkeit betont. Antworten bleibt das Stück bewusst schuldig.
Freilich, ein polterndes Agitationstheater, das die politischen Patentlösungen präsentiert, wäre auch keine Option, es bliebe ein unverstandener Anachronismus. Die Inszenierung schrammt in ihren Ansätzen allerdings an der Grenze zum kleinfamiliären Sozialporno, dessen Ästhetik der Ausweglosigkeit nur noch von einer Heilandssuche im finalen Krippenspiel unterbrochen wird. Österreich ist schließlich ein katholisches Land. Die Bühnenausstattung unterstreicht das mit obligatorischem Herrgottswinkel und holzgezimmertem Chorgestühl, dessen Toilettentauglichkeit ausreichend demonstriert wird. Der dramaturgische Einsatz von Körperflüssigkeiten ist weder neu noch besonders originell (die vom reichlichen Kunstblut benetzte erste Reihe durfte eine Pflichtübung dennoch kurz empört Pfui! rufen), scheint aber im launig dargestellten Konglomerat des österreichischen Kulturerbes aus Tourismus, Bergen, Sex, Blasmusik und Aktionismus unvermeidlich. Die dabei mit (Theater-)Blut gemalte Nationalflagge war einer der kleinen, erhellenden Momente im Stück.
Das städtisch sozialisierte, gut gekleidete (retro-chic!), akademisch gebildet und kunstbeflissen wirkende Premierenpublikum schien schon vor Beginn des Stücks hochzufrieden. An jenen Stellen, an denen die nichtdialektsprechenden Schauspieler pseudodialekt sprechende Nichtdialektsprecher imitierten, wurde am lautesten gelacht. So sind wir halt, wir Österreicher!
Die, die es betrifft, die Ausgesteuerten und Ausrangierten, waren an diesem Abend nicht im Schauspielhaus anzutreffen. Die ganze Soziologie des Theaters ist im Preis der Sitzplätze enthalten, schreibt Roland Barthes und für ein populäres Theater sind die Eintrittspreise im Schauspielhaus zu stolz, und das trotz oder gerade wegen? des reichlichen Sponsorings ausgerechnet durch den Glücksspielkonzern Novomatic, der durch diese Art der Kulturförderung im Grunde auch noch sein symbolisches Kapital mit jenen vermehrt, die unten angekommen sind. Die privatwirtschaftlichen Theaterhäuser und alle in diesem Betrieb beschäftigten, von den AutorInnen bis zu den SchauspielerInnen, sind auf ihre privaten Geldgeber angewiesen. Theater unter solchen Voraussetzungen kann seine Gelingensbedingungen nicht in Frage stellen und wird unkritisch bleiben.